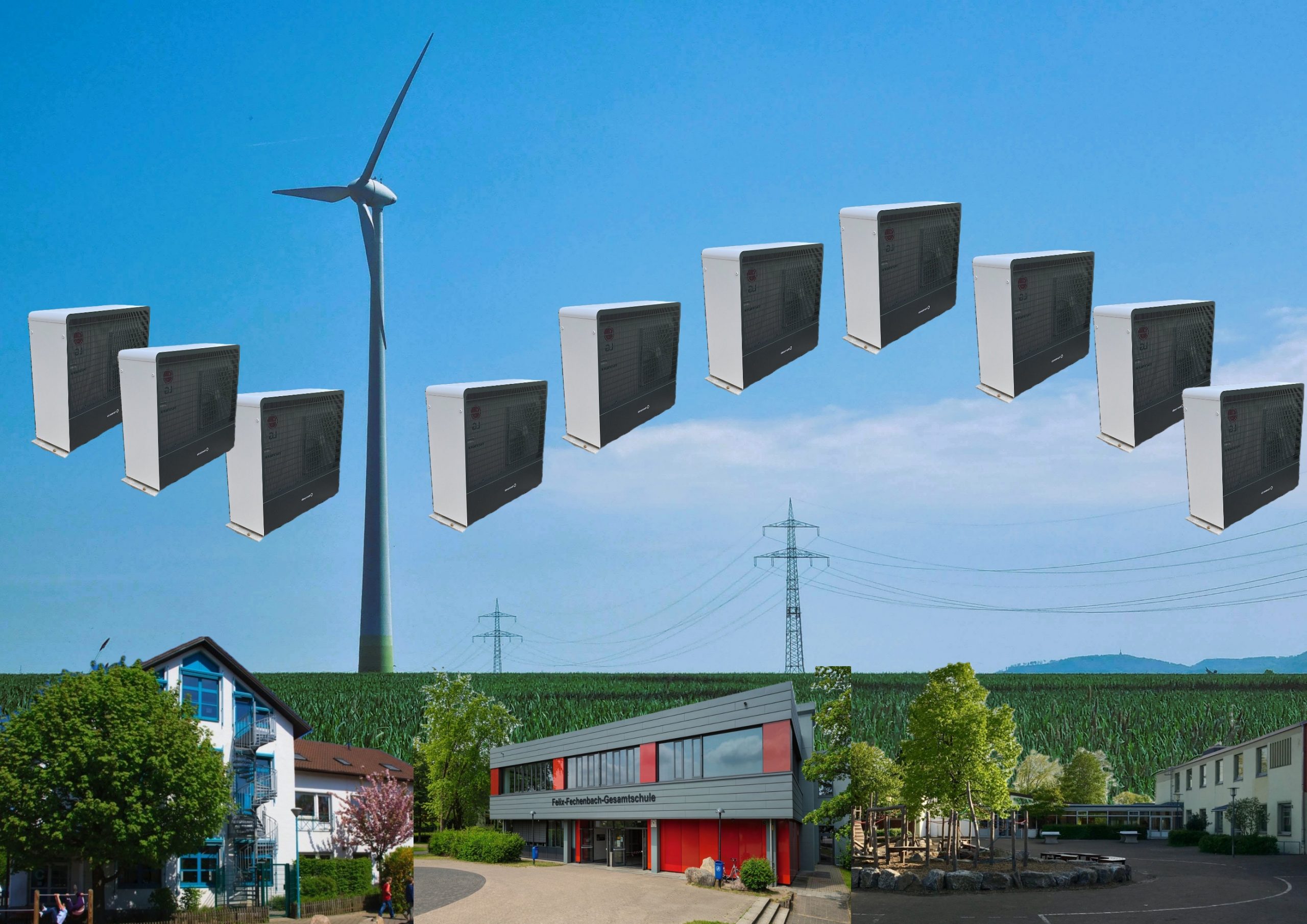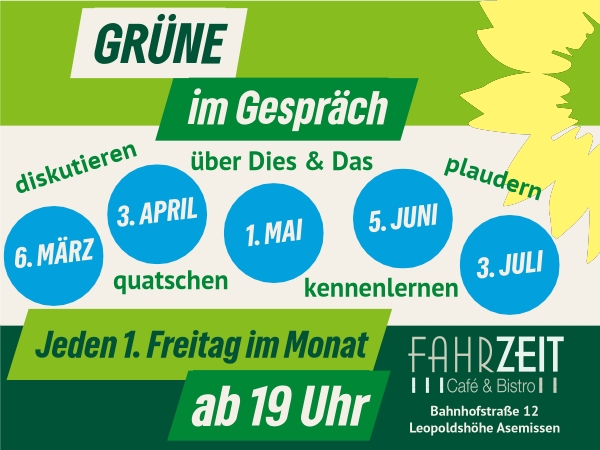Wenn wir in einigen Jahren am Schulzentrum Leopoldshöhe vorbeigehen, könnte dort etwas Selbstverständliches stehen: Gebäude, die ihre Wärme und Energie sauber, zuverlässig und bezahlbar aus erneuerbaren Quellen beziehen. Für die Kinder von heute wird das Normalität sein – für uns ist es ein Aufbruch.
Das Schwimmbad der Grundschule Nord wird zukünftig nicht mehr mit einer alten Gasheizung arbeiten, sondern mit einem intelligenten Mix aus Wärmepumpen, Sonnenkollektoren und einem Blockheizkraftwerk (BHKW). Dieses läuft zunächst mit Erdgas, ist aber so vorbereitet, dass es in Zukunft auch mit Biogas betrieben werden kann, das vor Ort erzeugt wird.
Aber Moment – warum brauchen wir überhaupt ein Blockheizkraftwerk, wenn schöne moderne oder alte Gebäude längst mit Wärmepumpen und Solarenergie auskommen? Und wäre Biogas nicht an anderer Stelle sinnvoller? Es gibt Branchen, in denen sich Gas kaum ersetzen lässt: in Hochtemperatur-Öfen der Industrie oder als Rohstoffe in speziellen chemischen Prozessen. Für ein Schulgebäude oder das Schwimmbad ist es dagegen keine zwingende Voraussetzung. Genau darum hatten Fachleute auch eine zweite Variante vorgestellt, günstiger und ohne Gas, sondern mit einer Kombination aus Sole, Luftwärmepumpe und Solarenergie. Den Beschluss der Gemeindegremien hier auf ein BHKW zu setzen, können wir nicht nachvollziehen.
Doch an der Grundschule Nord zeigt sich exemplarisch, worum es eigentlich geht: nicht um eine einzelne Technik, sondern um die Frage der Richtung. Welche Weichen stellt Leopoldshöhe jetzt, damit wir in zwanzig Jahren nicht wieder über teure Übergangslösungen diskutieren? Die Alternative zu teuren Einzelentscheidungen sind gemeinsame Wärmelösungen für ganze Quartiere. Anstatt jedes Gebäude isoliert mit einer eigenen Technik auszustatten, können zentrale Anlagen mehrere Schulen, öffentliche Gebäude oder sogar ganze Siedlungen versorgen. So nutzen wir vorhandene Technologien effizienter, sparen Kosten und vermeiden das Nebeneinander von vielen kleinen Insellösungen.
Ein großes Potenzial liegt etwa in der Nutzung der Erdwärme: Durch Bohrungen in den Boden können wir Wärme dauerhaft erschließen – ohne Erdgas oder andere Brennstoffe. Solche Konzepte wurden bereits durchgerechnet, aber mit dem Hinweis auf „Dringlichkeit“ oder „fehlende Umsetzbarkeit“ abgelehnt. Doch Dringlichkeit ist ein dehnbarer Begriff – schon vor zwei Jahren war sie ein Argument. Und bei der Finanzierung gilt: Es gibt zahlreiche Fördermittel, die ungenutzt bleiben, solange wir nicht mutig genug sind, solche zukunftsfähigen Lösungen umzusetzen. Doch Wärme allein reicht nicht. Jede Wärmepumpe, jedes Wärmenetz, jede zentrale Lösung braucht Strom. Deshalb hängt die Wärmewende direkt an der Stromwende. Und genau hier kommt die Windkraft ins Spiel. Über Windkraft wird viel diskutiert – oft hitzig, manchmal ängstlich. Wir sagen: Windräder sind kein Schreckgespenst, sondern eine Versicherung gegen steigende Energiepreise. Sie liefern Energie auch nachts und im Winter, wenn Solarmodule kaum Ertrag bringen. Selbstverständlich müssen unterschiedlichste Belange beachtet werden, die oft dazu führen werden, dass Anlagen nicht umsetzbar sind. Zum Beispiel sind manche Flächen ökologisch sensibel oder zu nah an Wohngebieten. Aber sich grundsätzlich gegen mögliche Windkraftanlagen in Leopoldshöhe zu stellen, ist keine zukunftsorientierte Lösung. Wir stehen hinter dem Ratsbeschluss für eine klimaneutrale Gemeinde Leopoldshöhe bis 2030. Wir müssen dafür keine Zukunftsvision erfinden – die Technik ist da, wir müssen sie nur lokal und klimaneutral einsetzen. Dafür braucht es Mut zu klaren Entscheidungen. Entscheidungen, die nicht nur den nächsten Winter im Blick haben, sondern die Zukunft der Kinder, die heute in den Grundschulen sitzen.